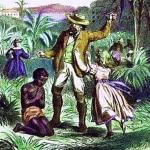Ein Land plant, die Scheiße, die es produziert, sich nützlicher zu machen
Finnland droht, in den nächsten Jahren in der eigenen Kacke zu ersaufen. Die Finnen produzieren jährlich eine Million Kubikmeter - also einhunderttausend Lastwagenladungen voll - an in Kläranlagen behandeltem Abwasserschlick aus den Versorgungsgemeinden. Nach gegenwärtigem Stand der Dinge wird ungefähr 96 Prozent dieser nährstoffreichen und reichlich organisches Element beinhaltenden Masse verwendet, in verschiedenster Form aufbereitet, so zum Beispiel als ein Bestandteil des Gartenhumus für den Anbau von Grünflächen.
- Die größten Anwendungszielobjekte sind im Zuge der im Jahr 1997 straffer gewordenen Müllplatz-Verordnung die Landschaftspflegearbeiten an den geschlossenen Schuttplätzen gewesen, erklärt der leitende Sachverständige fürs Abfallwesen Risto Saarinen aus der Zentralstelle Finnlands für die Umwelt.
Das Abdecken der jetzt aus dem Gebrauch genommenen Müllplätze geht jedoch seinem Ende entgegen. Wenn die Müllplätze den Schlick nicht mehr im gleichen Maße wie bisher aufschlucken, wird man in den kommenden Jahren gehalten sein, dafür neue Nutzungsweisen zu finden.
Gefährlichkeit aufgrund von Schwermetallen nicht mehr gegeben
Von der Schlickmasse wird deshalb mehr denn je für andere Objekte zur Verfügung stehen. Die potentiellen Anwendungsbereiche werden zum großen Teil die gleichen sein wie auch heute schon: die Ränder der Autostraßen, die Wegböschungen und die Parks. Die ganze Million Kubikmeter dürfte für jene allein allerdings nicht aufgehen.
- Eine Methode besonderer Art, wie man die Nährstoffe recyclen könnte, wäre die landwirtschaftliche Nutzung. Aus dem Klärschlamm angefertigte Produkte würden einem vom landwirtschaftlichen Anbau ausgelaugten Feld auch Kohle zuführen, was man bei Kunstdünger nicht hat, führt Saarinen aus.
- Ebenso wären die sich überlagernden Auswirkungen beachtlich. Je gelockerter die Erde ist, desto besser bindet sie Nährstoffe ein und verhindert deren Abfluß. Für den Schutz des Schärenmeers zum Beispiel wäre das Einbringen des Schlicks von wahrem Nutzen.
Die Landwirtschaft verbraucht von dem jährlich anfallenden Klärschlamm der Versorgungsgemeinden nur drei Prozent. Das Ironische daran ist, sollte auch die gesamte jährlich aufkommende Million an Schlammwasserkubikmetern auf die Felder gebracht werden, daß dieses lediglich einige wenige Prozent des jährlichen Düngerbedarfs der Landwirtschaft deckte.
Die Bauern scheuen nicht umsonst vor dem Einsatz des Schlicks zurück, denn in früheren Zeiten war jener stark schwermetallhaltig.
- Während der letzten Jahre ist die Abwasseraufbereitung gewaltig weiterentwickelt worden, und auch die Gefahr durch Schwermetalle ist nicht mehr gegeben, klärt Saarinen auf.
Die Schwermetallhaltigkeit hat in den Schlammassen unter anderem deshalb beträchtlich abgenommen, da das in Zahnfüllungen verwendete Amalgam und die für die Entwicklung von Fotografien gebrauchten Flüssigkeiten nicht mehr ins Abwasser gelangen.
- Das vor ein paar Jahren neu aufgelegte Düngemittelgesetz stellte strengere Anforderungen an den in Grund und Boden einzubringenden Klärschlamm und dessen Überwachung ist im Zuge davon zufriedenstellend geworden.
Saarinen sagt, daß die Schlammassen derart überwältigend werden, daß es höchste Zeit wäre, sich zu einem Konsens bezüglich deren Nutzungszielobjekten durchzuringen.
Die Frage des guten Geschmacks bestimmt über die Nutzung
Der Zentralverband der Forst- und Landwirtschaftlichen Produzenten Finnlands MTK [Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto] hat über Jahre hinweg die Nutzung auf den Feldern der aus dem Klärschlamm der Versorgungsgemeinden angefertigten Düngemittel wegen Problemen mit deren Qualität abgelehnt. Nachdem seit einigen Jahren die Preise für Kunstdünger in astronomischen Zahlen sich bewegen, hat das MTK sich bereiterklärt, in der Sache einzulenken.
- Im Lichte der Forschungsergebnisse widersetzen wir uns nicht mehr einer Nutzung des Schlicks. Der offizielle Standpunkt des MTK steht jedoch weiterhin zur Debatte und es dürfte gegen Ende des Jahres zu einem Einvernehmen kommen, kommentiert die Umweltbeauftragte des MTK Johanna Ikävalko.
Sämtliche Kreise scheinen einhellig der Meinung zu sein, daß es vernünftig wäre, die Nährstoffe einem Kreislauf zuzuführen. Auf der zuständigen Kontrollbehörde, Evira genannt, die die Qualität der aus Klärschlamm gewonnenen Düngeerzeugnisse überprüft, wird angemerkt, daß über die Verwirklichung der Praxis auch noch die Frage des guten Geschmacks bestimme.
- Die damit verbundenen Risiken hätten wir gut im Griff, betont der leitende Kontrolleur bei Evira, Olli Venelampi.
- Das Problem mit dem Image, das in der Natur der Sache liegt, ist nach wie vor das größte dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob wir bereit sein sollten, dieses Risiko auf uns zu nehmen, daß die Verbraucher keine in menschlichen Exkrementen herangezüchteten Lebensmittel kaufen würden, gesteht Johanna Ikävalko aus dem MTK ein.
- Die größten Anwendungszielobjekte sind im Zuge der im Jahr 1997 straffer gewordenen Müllplatz-Verordnung die Landschaftspflegearbeiten an den geschlossenen Schuttplätzen gewesen, erklärt der leitende Sachverständige fürs Abfallwesen Risto Saarinen aus der Zentralstelle Finnlands für die Umwelt.
Das Abdecken der jetzt aus dem Gebrauch genommenen Müllplätze geht jedoch seinem Ende entgegen. Wenn die Müllplätze den Schlick nicht mehr im gleichen Maße wie bisher aufschlucken, wird man in den kommenden Jahren gehalten sein, dafür neue Nutzungsweisen zu finden.
Gefährlichkeit aufgrund von Schwermetallen nicht mehr gegeben
Von der Schlickmasse wird deshalb mehr denn je für andere Objekte zur Verfügung stehen. Die potentiellen Anwendungsbereiche werden zum großen Teil die gleichen sein wie auch heute schon: die Ränder der Autostraßen, die Wegböschungen und die Parks. Die ganze Million Kubikmeter dürfte für jene allein allerdings nicht aufgehen.
- Eine Methode besonderer Art, wie man die Nährstoffe recyclen könnte, wäre die landwirtschaftliche Nutzung. Aus dem Klärschlamm angefertigte Produkte würden einem vom landwirtschaftlichen Anbau ausgelaugten Feld auch Kohle zuführen, was man bei Kunstdünger nicht hat, führt Saarinen aus.
- Ebenso wären die sich überlagernden Auswirkungen beachtlich. Je gelockerter die Erde ist, desto besser bindet sie Nährstoffe ein und verhindert deren Abfluß. Für den Schutz des Schärenmeers zum Beispiel wäre das Einbringen des Schlicks von wahrem Nutzen.
Die Landwirtschaft verbraucht von dem jährlich anfallenden Klärschlamm der Versorgungsgemeinden nur drei Prozent. Das Ironische daran ist, sollte auch die gesamte jährlich aufkommende Million an Schlammwasserkubikmetern auf die Felder gebracht werden, daß dieses lediglich einige wenige Prozent des jährlichen Düngerbedarfs der Landwirtschaft deckte.
Die Bauern scheuen nicht umsonst vor dem Einsatz des Schlicks zurück, denn in früheren Zeiten war jener stark schwermetallhaltig.
- Während der letzten Jahre ist die Abwasseraufbereitung gewaltig weiterentwickelt worden, und auch die Gefahr durch Schwermetalle ist nicht mehr gegeben, klärt Saarinen auf.
Die Schwermetallhaltigkeit hat in den Schlammassen unter anderem deshalb beträchtlich abgenommen, da das in Zahnfüllungen verwendete Amalgam und die für die Entwicklung von Fotografien gebrauchten Flüssigkeiten nicht mehr ins Abwasser gelangen.
- Das vor ein paar Jahren neu aufgelegte Düngemittelgesetz stellte strengere Anforderungen an den in Grund und Boden einzubringenden Klärschlamm und dessen Überwachung ist im Zuge davon zufriedenstellend geworden.
Saarinen sagt, daß die Schlammassen derart überwältigend werden, daß es höchste Zeit wäre, sich zu einem Konsens bezüglich deren Nutzungszielobjekten durchzuringen.
Die Frage des guten Geschmacks bestimmt über die Nutzung
Der Zentralverband der Forst- und Landwirtschaftlichen Produzenten Finnlands MTK [Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto] hat über Jahre hinweg die Nutzung auf den Feldern der aus dem Klärschlamm der Versorgungsgemeinden angefertigten Düngemittel wegen Problemen mit deren Qualität abgelehnt. Nachdem seit einigen Jahren die Preise für Kunstdünger in astronomischen Zahlen sich bewegen, hat das MTK sich bereiterklärt, in der Sache einzulenken.
- Im Lichte der Forschungsergebnisse widersetzen wir uns nicht mehr einer Nutzung des Schlicks. Der offizielle Standpunkt des MTK steht jedoch weiterhin zur Debatte und es dürfte gegen Ende des Jahres zu einem Einvernehmen kommen, kommentiert die Umweltbeauftragte des MTK Johanna Ikävalko.
Sämtliche Kreise scheinen einhellig der Meinung zu sein, daß es vernünftig wäre, die Nährstoffe einem Kreislauf zuzuführen. Auf der zuständigen Kontrollbehörde, Evira genannt, die die Qualität der aus Klärschlamm gewonnenen Düngeerzeugnisse überprüft, wird angemerkt, daß über die Verwirklichung der Praxis auch noch die Frage des guten Geschmacks bestimme.
- Die damit verbundenen Risiken hätten wir gut im Griff, betont der leitende Kontrolleur bei Evira, Olli Venelampi.
- Das Problem mit dem Image, das in der Natur der Sache liegt, ist nach wie vor das größte dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob wir bereit sein sollten, dieses Risiko auf uns zu nehmen, daß die Verbraucher keine in menschlichen Exkrementen herangezüchteten Lebensmittel kaufen würden, gesteht Johanna Ikävalko aus dem MTK ein.
libidopter - 3. Okt, 09:41