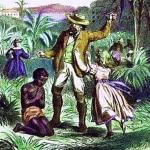Wo Wirklichkeit wie Musik schwingt - fast so flott wie in einer Welt, wo alles fließend auch ganz ohne Geld zusammenharmoniert
Musik für Augen - der Avantgarde-Film des Frankreichs der 1920er: Germaine Dulac, Abel Gance, Henri Chomette, Man Ray...
Konsumenten der Hochkultur suchen ihre Kunstgenüsse wohl kaum im Angebot des Music Television. Überraschenderweise zeigt sich jedoch in der Kulturerscheinung der Musikvideos der Einfluß der Ästhetik des französischen Avantgarde-Films der 1920er
(ein Beitrag des finnischen Kulturjournals Kaltio aus Anlaß des Musikvideofestivals von Oulu vom 28. & 29. August 2004, übersetzt aus dem Finnischen)
"Musik aus Licht"
"Visuelle Symphonie". In derlei Begriffen sprach man vom Film im Frankreich der 1920er. Den führenden Köpfen der Avantgarde jener Zeit bestand der wichtigste Charakterzug des Stummfilms nicht in seiner Fähigkeit, Geschichten erzählen zu können, sondern in seinen visuellen Möglichkeiten. Anstelle davon, daß der Film als etwas den erzählerischen Formen in der Kunst, dem Theater und dem Roman Ähnliches begriffen wurde, vertrat man die Ansicht, daß er vor allen Dingen der Musik nahekomme.
Der Ausgangspunkt für einen Vergleich mit Musik war an und für sich einleuchtend gewesen: was die Musik für die Ohren ist, dies sollte der Film für die Augen sein - eine sichtbar werdende Musik. Paradoxerweise wurde diese Denkart gerade durch die Stummheit des Films noch unterstrichen: wo der Ton fehlt, hat der Film auf sein Publikum durch visuelle Mittel Einfluß zu nehmen. Wenn Musik mittels von Klängen, ohne, daß sie eine Geschichte erzählte, Gedanken und Gefühle erregen kann, dachte man sich, der Film könne mittels von Bildern das gleiche tun. Diese Idee formierte sich zu einer These der Avantgarde des französischen Films, die ganz im Mittelpunkt zu stehen kam.
Geschichten sind oberflächlich
Die Avantgarde der 1920er Frankreichs wird für gewöhnlich in eine erste und eine zweite Avantgarde aufgeteilt. Besonders der zu Anfang der 1920er vorherrschenden, als Erste Avantgarde oder Impressionismus bezeichneten Ausrichtung galt es als etwas wichtiges, die besondere Natur des Films aufzuspüren, einen Charakterzug zu finden, der ihn von den anderen Formen der Kunst unterschiede. Einen solchen sah man in der "Photogénie", der Fähigkeit der Filmkamera, die aufgezeichnete Realität zu einem Niveau anzuheben, wo diese sich auf eine neue und zuvor nicht wahrgenommene Art und Weise präsentiere. Obwohl impressionistische Filme denn auch Geschichten erzählten, war die Story oft nur Ausgangsbasis zum Hervorbringen der als dem Medium Film eigentlich innewohnend betrachteten Eigenschaften. Der den Spitzennamen der Impressionisten zuzurechnende Jean Epstein bemerkte im Jahre 1921: "Im allgemeinen vermittelt ein Film Geschichten nicht gut. (...) Warum also Geschichten erzählen, Stories, die immer eine Chronologie, hintereinander ablaufende Geschehnisse, ein graduelles Wechselspiel von Fakten und Emotionen voraussetzen? (...) Es gibt gar keine Geschichten. Geschichten hat es nie gegeben. Es gibt nur Situationen, ohne Kopf und Schwanz; ohne Anfang, ohne Mittelpunkt oder Schluß." "Natürlich kann ein Film eine Geschichte erzählen," bemerkte ihrerseits die sich zu den im Mittelpunkt stehenden Impressionisten zählende Germaine Dulac, "aber die Story allein ist noch nichts. Die Geschichte ist etwas oberflächliches."
Obwohl als erzählerisch einzustufende impressionistische Filme bis zum Ende der 1920er gemacht wurden, begann bereits vor Mitte der 1920er die Idee, daß man völlig und ganz auf eine Story verzichten könnte, immer stärker an Boden zu gewinnen. Der Gedanke als solcher war eigentlich nichts neues. Bereits im Jahre 1914 hatte der Kunstmaler Léopold Survage seine Vorstellung vom Film als einer Fortsetzung der abstrakten Kunstmalerei vorgestellt, als einer nicht-darstellenden, nicht-erzählerischen Malerei, als einen "Rhytmus von bunten Farben". Die Grundelemente eines "bunten Rhytmus" seien abstrakte visuelle Form, Rhytmus (anders herum gesagt, Bewegung und die mit ihr in der Form passierenden Veränderungen) und Farbe. Weiterhin stellte Survage fest, daß ein solches Werk vor allem mit Musik zu vergleichen wäre: auch bei einem "Rhytmus von bunten Farben" handelte es sich um Veränderungen in der Form, die in der Zeit vonstatten gehen.
Durchbruch des rhytmischen Schnitts
Einen bemerkenswerten Anschub der Idee des "musikalischen Films" leistete das von Abel Gance, dem vielleicht bekanntesten Vertreter des impressionistischen Films, im Jahre 1922 fertiggestellte, ins Eisenbahn-Milieu platzierte Melodrama La Roue ("Das Rad"). Der Film wurde zu einem Ereignis, von dem man im Frankreich der anfänglichen 1920er Notiz nahm. Dessen ursprüngliche Version belief sich von der Spieldauer her auf fast neun Stunden, und die Uraufführung für ein geladenes Publikum von 6000 Menschen im Dezember 1922 mußte auf drei aufeinander folgende Donnerstage verteilt werden. Nachdem die letzte Show beendet war, brach das Publikum in einen derartigen Sturm der Begeisterung aus, daß er nicht mehr enden wollte, vordem daß des Films letzter Streifen ein weiteres Mal abgespielt würde.
La Roue bereicherte den Impressionismus um ein neues Element. Obwohl der Film auch weiterhin eine Story hatte, enthielt er ebenso neuartige, rhytmisch geschnittene Montage-Abschnitte, die nahezu eigenständige, von der Erzählung und Geschichte abstehende Zusammenhänge bildeten - wie in belebten, blitzlichtartigen Bildern, von schneller werdendem Rhytmus, einer Eisenbahnstrecke, der Räder eines Zuges und Teile der Lok. Der rhytmische Schnitt des Films rief weit und breit Interesse hervor, und es gebrauchten ihn als ihr Lehrmaterial zum Beispiel die heranwachsenden Repräsentanten der Montage-Strömung in der Sowjet-Union. Den bedeutendsten Einfluß übte La Roue jedoch in Frankreich aus. Der Film-Klub C.A.S.A (Club des amis du septième art, "Klub der Freunde der siebenten Kunst") veranstaltete eine Sonderaufführung, während welcher von dem Film La Roue einzig und allein die nicht-erzählerischen Sequenzen, die hauptsächlich aus rhytmischen Schnitten bestanden, gezeigt wurden. Die Montage-Abschnitte des Films haben ganz entschieden dazu beigetragen, daß die sogenannte "Zweite Avantgarde" in den 1920ern zum Leben entfacht wurde, die sich schlußendlich vollständig vom Erzählerischen lossagte.
Kino Pur
Zu den sichtbarsten Bewunderern von La Roue zählte Germaine Dulac. Dulac war eine der bemerkenswertesten und vielseitigsten Gestalten der 1920er sowohl als Filme-Macherin als auch als Theoretikerin und eine der wenigen weiblichen Filme-Macher ihrer Zeit. Sie hatte sich zu Beginn ihrer Karriere gleich darauf verlegt, impressionistische Filme zu produzieren; zu den bekanntesten Werken aus Dulacs impressionistischer Zeit gehört die ironische Inszenierung einer unglücklichen Ehe, La Souriante Mme Beudet ("Die lächelnde Frau Beudet, 1923). Dulac machte sich auch als Regisseurin für einen der wenigen surrealistischen Filme, den auf das Drehbuch von Anton Artaud zurückgehenden Film La Coquille et le Clergyman ("Die Schnecke und der Pfaffe", 1927). Am ehesten erinnert man sich jedoch an Dulac als eine Verfechterin des sogenannten Kino Pur (cinema pur) - und gerade hier stellte das Stück La Roue von Gance eine äusserst wichtige Quelle der Inspiration dar. "Die menschlichen Figuren waren nicht mehr nur der einzige Faktor; neben diesen gelangten eher auch die Dauer von Bildern, deren Kontraste und Harmonien zu einer Schlüsselstellung. Die Schienen, die Lokomotive, der Dampfkessel, die Räder, der Druckmesser, der Rauch und die Tunnel: das jüngste Drama entfaltet sich mit ungeschliffenen, aufeinander abfolgenden Bewegungsablaufen und mit sich krümmenden Linien, und es bekommt die Anschauung, daß in Bewegung eine Kunst liegt ihre Berechtigung; endlich führt uns diese, rationell besehen, einem symphonischen Gedicht von Bildern, einer visuellen Symphonie entgegen, die alle bisher bekannten Schablonen sprengt," schrieb Dulac über La Roue.
Der Grundgedanke des reinen Films im Kino Pur war der, daß der Film zu reinem Gefühl zurückkehre, welches anstelle von einer Geschichte mit Hilfe von Mitteln erreicht würde, die ureigentümlich für den Film seien - die der Visualität, der Bewegung und des Rhytmus. Zielstellung des reinen Films war es, rein durch das Visuelle einen Einfluß auf Gefühle geltend zu machen, anders wie der sich auf das Theater gründende erzählende Spielfilm, welcher Gefühle durch äußere Mittel zu erreichen sucht, indem er Figuren von Personen und deren Schicksale als "Vermittler" der Gefühle einsetzt. Im Gegensatz zu theatralischer Sentimentalität sollte der Film nach Art von Musik Gefühle erwecken, indem er direkt auf die Wahrnehmung und die Sinnlichkeit einwirken kann. Dulac erklärt ihre Vorstellungen anhand des Beispiels von einem Blinden in einem Lichtspielhaus. Wenn in einem Kino ein gewöhnlicher Film mit einer Story vorgestellt würde, und der Blinde eine Begleitperson bei sich hätte, die ihm berichtete, was sich in dem Film tut, könnte der Blinde von den emotionellen Eindrücken des Films zumindest eine gute Hälfte erfahren. Anstelle davon sei der reine Film etwas, dessen visuelle Erfahrung einem Blinden zu erklären unmöglich ist.
Dulac setzte in der Praxis ihre Prinzipien auch in Taten um. Zu Ende der 1920er schuf sie eine Reihe von Kurzfilmen, die den Grundsätzen des reinen Films folgten, wie zum Beispiel Disque 972 ("Scheibe 972", 1928), Thèmes et variations, ("Themen und Variationen", 1928) und Étude cinégraphique sur un arabesque ("Lichtspieltechnische Übung zu einer Arabesque", 1929). Doch schon zuvor hatte ein gewisser Henri Chamotte sich die Idee des reinen Films in Kurzfilmen von ihm zur Mitte der 1920er zueigen gemacht, die so klingende Namen hatten wie Les jeux des reflets et de la vitesse ("Spiele von Reflexionen und Geschwindigkeit", 1925) und Cinq minutes de cinéma pur ("Fünf Minuten Kino Pur", 1925).
Fragmente: Ballet Mécanique
Ähnlich wie Dulac begeisterte sich auch der kubistische Kunstmaler Fernand Léger für die Montage-Sequenzen in La Roue. Außerdem, daß Léger bei dessen Erstaufführung unter den geladenen Gästen war, hatte er auch die Aufnahmen des Films vor Ort mitverfolgt. Beflügelt durch die Montage-Sequenzen des Films, schrieb Léger in einem Essay, daß in La Roue "aus der Maschine die führende Personengestalt, der führende Darsteller wird", und verglich den Film mit moderner Malkunst, bei der die Fragmentation des vorgestellten Objekts und der visuelle Wert des Objekts als solcher im Mittelpunkt stehe. Léger machte sich auch daran, einen völlig abstrakten Film zu entwerfen, bei dem das narrative Element ganz und gar ausgelichtet würde. Er konnte den amerikanischen Filme-Macher Dudley Murphy als seinen Kollegen gewinnen, und als das Endergebnis war im Jahre 1924 das Mechanische Ballett (Ballet Mécanique) fertiggestellt worden. Ballet Mécanique dürfte wohl der bekannteste Film der 1920er sein, von dem man sagen kann, daß er den Grundsätzen des puren Films folgt. Der Film baut sich auf gewissen sich wiederholenden Formen und Bewegungen auf. Zentrales Thema sind darin runde Formen und Kreisbewegungen, welche im Film auf vielerlei Art variiert werden. In dem Film kommen sowohl auf die gewöhnliche Weise gedrehte, als auch animierte Sequenzen vor (wie z.B. eine gezeichnete Chaplin-Figur). Aber auch die gewöhnlichen "etwas darstellenden" Bilder jedoch werden abstrahiert präsentiert, indem sie zu Fragmenten gemacht, sie aus ihren Bezügen herausgelöst sind. Durch den Einsatz von Nahaufnahmen werden gewöhnliche Gegenstände - oft verschiedenerlei Maschinen - so verändert dargestellt, daß sie nicht erkenntlich werden. Andererseits wird das Darstellerische der Bilder durch Wiederholungen zunichtegemacht. Ein markanteste Beispiel dafür ist eine vielmals hintereinander sich wiederholende Aufnahme einer treppensteigenden Waschsalon-Dame. Die Wiederholungen lenken das Beachten dessen, was das bewegte Bild eigentlich darstellt, ab, dahingehend, daß man auf das Bild als solches aufmerksam wird, welches sich rein in einer mechanischen Bewegung erschöpft. "In erster Linie wollte ich das Publikum verblüffen," erklärt Léger zu den Aufnahmen, "dann sollten sie dazu gebracht werden, verzweifelt nach einer Lösung des ganzen zu suchen, und zum Schluß dahin, daß sie ganz der Verzweiflung verfallen." Um die Anzahl der Wiederholungen zeitlich richtig abzustimmen, präsentierte Léger verschiedenen Publiken verschiedene Versionen, um herauszufinden, was am ehesten den von ihm erstrebten Effekt zeitigt.
"100% Dada"
Die von der Erzählkunst sich befreiende Zweite Avantgarde war jedoch nicht nur der "reine Film". Das Feld der Avantgarde in der Zeit wies eine Fülle von auseinanderlaufenden Gruppierungen und Strömungen auf. Ein und der gleiche Film konnte sehr wohl unter unterschiedlichen Betitelungen laufen. So wurde zum Beispiel vom Mechanischen Ballett als einem "abstrakten Film" und einem "kubistischen Film" gesprochen; ein gewisser Schriftsteller bemerkte sogar, daß "obwohl Léger eigentlich kein Dadaist ist, sein Ballet Mécanique 100% Dada ist." Gerade der Dadaismus und der als dessen Nachfolger zur Mitte der 1920er aufgekommene Surrealismus zählten neben dem "reinen Film" zu den bemerkenswertesten Strömungen der Zweiten Avantgarde. Anders wie Impressionismus und der reine Film suchten jedoch Dadaismus und Surrealismus nicht danach, den Film zur Kunst werden zu lassen; viel eher ließen sie sich eine Provokation, eine Opposition zu jeglicher Rationalität und ein In-Frage-Stellen der Position der Kunst angelegen sein. Wenn der Film keine "Kunst" war, bestand auch keine Notwendigkeit, ihn als "Musik" zu begreifen. Obwohl die Ausgangspunkte der Dadaisten und Surrealisten zur Idee des reinen Films von einander abwichen, gab es in etlichen fertiggestellten Filmen die gleichen Züge. Eine der auffallendsten Figuren sowohl auf dem Lager des Dada wie auch des Surrealismus war der in Frankreich sich eingelebte, amerikanische Photograph und bildende Künstler Man Ray (eig. Emmanuel Rudnitsky). Im Juli 1923 hatte Man Ray in Eile für eine von Tristan Tzara, der Leitfigur des Pariser Dada, in Szene gesetzte Abendgesellschaft, der "Coeur à barbe" (Bärtiges Herzen), den mehrminütigen Film Retour à la raison ("Die Rückkehr zur Vernunft") zusammengestellt. Der Film von Ray beinhaltet unter anderem auf Straßen und in Lustgärten aufgenommenes Material sowie direkt auf Film belichtetes Stückwerk. "In einige Fetzen des Films streute ich Salz und Pfeffer hinein wie ein Koch, der einen Braten zubereitet, in anderen vermischte ich kreuz und quer Pflöckchen und Stecknadeln, und ich belichtete dieses dann ein bis zwei Minuten," beschrieb Man Ray den Herstellungsprozeß des Films. Obwohl die ursprüngliche Idee zu diesem Film eine andere war, kann man auch diesen Film ähnlich dem Ballet Mécanique als einen abstrakten und vielleicht auch in gewisser Weise als einen "musikalischen" Film sehen. Das Soirée zum Coeur à barbe endete in einem skandalösen Zwischenfall, als der Anführer der opponierenden Gruppe von Surrealisten, André Breton, sich dazu hatte hinreißen lassen, auf einen bestimmten der aufgetretenen Schauspieler mit seinem Spazierstock einzuschlagen. Dieses Ereignis wird als die Beendigung der eigentlichen Dada-Strömung angesehen, welche durch den Surrealismus von Breton und Kollegen verdrängt wurde.
Der Traumblick
Auch die Surrealisten waren am Film interessiert. Für viele Surrealisten stellte der Film an und für sich etwas surrealistisches dar - er eröffnete den Weg zu einer die Alltäglichkeit übersteigenden, traumgleichen Erfahrung. André Breton pflegte die Angewohnheit, an Sonntagnachmittagen sich zufällig herausgesuchte Filmvorführungen anschauen zu gehen, und zwar solcherweise, daß er eine Zeitlang einem Film zuschaute, sich dann sogleich aufmachte, einem anderen eine Weile zuzuschauen, und so weiter fortfahrend. Das Resultat davon war, daß eine surrealistische Filmerfahrung aufkam, eine im Geiste des Betrachtenden entstehende, aus losen, aufblitzenden Streifenbildern sich zusammensetzende, unlogische, traumgleiche Bildmontage. Mit der gleichen Masche ging auch Man Ray vor, der zusätzlich an seine Augengläser farbige, das Licht brechende Prismen geklebt hatte, sodaß Filme in Schwarz-Weiß sich ihm als abstrakte Farbbilder zeigten. Surrealisten schrieben auch zahlreiche Filmdrehbücher, im Endeffekt wurden aber nur wenige richtiggehend surrealistische Filme gedreht. Der "Papst des Surrealismus" Breton hielt steif und fest an seinem Recht fest, bestimmen zu dürfen, was "echter" Surrealismus ist und was nicht. Der Abend der Erstaufführung von Dulacs La Coquille et le Clergyman geriet zu einem Chaos, da Breton und Kollegen im Lichtspielhaus eine skandalöse Szene anzettelten und Dulac blöde Kuh schimpften. Zum Schluß war der einzige Film in den 1920ern, den Breton mit seiner Gruppe - selbst darüber verblüfft - als surrealistisch durchgehen ließ, Un Chien andalou ("Ein andalusischer Hund", 1929) von Luis Buñuel und Salvador Dalí - wenngleich Dalí sich auf ein mögliches Szenario vorbereitet hatte, indem er Straßensteine im Vorführungssaal sich als Wurfgeschosse aufgebaut hatte.
Ein weiterer Versuch auf einen surrealistischen Film stellte das durch Man Ray im Jahre 1926 zustande gekommene "Filmgedicht" Emak Bakia vor; der Titel des Films war in baskischer Sprache und bedeutete "Laß mich in Frieden". In dem Film war teilweise gleiches Material zu sehen wie im Film Retour à la raison, doch ist er entschieden länger. Man Ray gibt von sich, daß er in dem Film versucht hätte, allen zugrundeliegenden Leitgedanken des Surrealismus Folge zu leisten - dem Irrationalismus, dem Automatismus, dem Sich-Lossagen von sichtbarer, dramatischer Logik und vom gewöhnlichen Erzählverlauf. Die bekannteste Bilderreihe des Films ist zu dessen Schluß, in der eine Frau mit glotzigen Augen in die Kamera schaut. Plötzlich öffnet sie dann ihre Augen: es zeigt sich, daß die zuvor gesehenen "Augen" nur auf die Lider aufgemalt waren. Diese Bildersequenz ist so ausgelegt worden, als daß sie sich auf die zwei unterschiedlichen Arten des "Sehens" beziehe - zum einen auf das Betrachten der gewöhnlichen Wirklichkeit und zum andern auf die mit geschlossenen Augen "zu schauende" surrealistische Welt der Träume und des Unbewußten. Zum Verdruß von Man Ray akzeptierte die Gruppe der Surrealisten den Film nicht. Weitere Filme von Man Ray waren L'étoile de mer ("Der Meeresstern", 1928) und Les Mystères du château du dé ("Die Geheimnisse des Loswürfel-Schlosses", 1929), für die der surrealistische Dichter Robert Desnos die Drehbücher handgeschrieben hatte.
Man Ray ist ein gutes Beispiel für eine Figur, die zwischen den verschiedenen Gruppen hin- und herlavierte. Eine Zeitlang war er mit dabei beim Drehprozeß für das Ballet Mécanique, wobei er offensichtlich auch einige für den Film verwendete Einstellungen aufgenommen hatte. Als mitwirkender Schauspieler war Man Ray 1924 in einem zweiten, wichtigen Film des gleichen Jahres mit von der Partie gewesen, in dem unter der Regie von Henri Chamottes Bruder René Clair (eig. René Chamotte) entstandenen Film Entr'acte ("Zwischenspiel"). Obwohl die eigentliche Dada-Bewegung mit der Szene auf der Coeur à barbe-Abendgesellschaft ihr Ende gefunden hatte, wurde Entr'acte weiterhin als ein dadaistischer Film angesehen. Seinem Namen zufolge war er als Zwischenspiel gedacht, und zwar für das avantgardistische Ballett Relâche ("Auftrittspause") von Francis Picabia. Das Drehbuch stammte von Picabia, nebst welchem, von hervorstehenden Avantgarde-Figuren, Man Ray, der bekannte Dada-Künstler Marcel Duchamp sowie der Komponist Eric Satie in dem Film Auftritte hatten. Eine "Tonspur" des Films sollte sich aus Gelärme und Gegenreden des aufgebrachten Publikums ergeben. Der Film selbst setzt sich aus einer Reihe von komischen Gags zusammen, in denen zum Beispiel unter anderen eine bärtige Ballerina, Picabia selbst, wie er mit einem Feuerwehrschlauch den Schach spielenden Man Ray und Duchamp vollspritzt, eine Jagd auf ein Straußenei, sowie eine Beerdigungsgesellschaft, die zu einem verworrenen Durcheinander ausartet, zu sehen sind. Im Programmprospekt der Inszenierung schrieb Picabia: "Das 'Entr'acte' bekennt sich nicht zu sehr vielem, vielleicht jedoch zum Genießen des Lebens; es glaubt eben an den Spaß des Erfinderischseins, es respektiert nichts weiter als das Verlangen, in Lachen auszubrechen."
Die Nachklänge: von der Musik der Bilder zum Musikvideo
Der Durchbruch des Tonfilms, als man auf die 1930er zuging, brachte das Ende eines Films mit sich, der sich an der Kraft des Bildes orientiert hatte. Die Sprache ersetzte die mit bildlichen Mitteln erzielten Effekte und der Film wurde zu dem von der Generation der 1920er scheel beäugten "gefilmten Theaterspiel". Die "reine", von jeglicher Erzählhandlung losgelöste Art und Weise, durch bewegte Bilder etwas zum Ausdruck zu bringen, war jedoch damit nicht ganz und gar verschwunden, sondern hatte ihren Fortbestand in verschiedenen Projekten der Avantgarde und bis zu einem gewissen Grad auch innerhalb des Mainstream-Films für die breiten Massen. Ein neues Beispiel für dessen Lebendigkeit ist das seit gut letzten zwei Jahrzehnten sich durch die Räume bewegende Musikvideo. Bei einem Musikvideo kann man vielleicht nicht gerade von einem Avantgarde-Film im eigentlichen Sinne des Wortes sprechen. Als eine Erscheinungsform des Ausdrucks hat es jedoch auf den weitspurigen Gefilden des Films als marginal verbliebene Mittel des filmischen Ausdrucks erneut zu einem sichtbaren Bestandteil der audiovisuellen Kultur gemacht. Da die Aufmachung bei einem Musikvideo nichts mit dem Erzählen von einer Geschichte zu tun zu haben braucht, bietet es sich an, dadurch sich Ausdruck zu verleihen, indem das Bild und die visuelle Kunst an der Stelle einer Story ganz in den Fokus genommen wird.
Ein "reines" Musikvideo gibt es jedoch nicht; in einzelnen Videos lassen sich auf unterschiedlichsten Wegen verschiedenartigste audiovisuelle und andere kulturelle Ausdrucksformen nutzen. In Anbetracht der Stellung des erzählenden Spielfilms ist es kein Wunder, daß in etlichen Videos auch dessen Methoden zur Anwendung kommen. Ein typisches erzählerisches Element in einem Video ist der auftretende Artist oder die Gruppe, um die herum das Ganze verankert ist. Auch mit Hilfe von Plätzen, seinem Aufzug und mit bestimmten Gegenständen kann eine "Erzählwelt" um die Auftretenden herum aufgebaut werden. Oft enthalten Videos Bruchstücke einer Erzählung oder sie formieren sich zu in sich abgeschlossene Minigeschichten.
Nichtsdestotrotz haben die Musikvideos dazu beigetragen, Stilmittel, die ohne ein Erzählen auskommen, die früher der Avantgarde zugerechnet wurden, zu einem festen Teil der populären Mainstream-Kultur werden zu lassen. Bei Musikvideos kann man innerhalb den Einstellungen beliebig von einem Ort und einer Zeit zur andern springen, und beim Schnitt kommen oft Rhytmus und Bewegungen eine wichtigere Bedeutung zu als dem Aufrechterhalten einer erzählerischen Einheit. Die Erkennungsmerkmale des "reinen" Films der 1920er, die Betonung des Visuellen, Bewegungsabläufe und deren Rhytmik machen den Kern ebenso des Musikvideos aus.
Die drei Grundpfeiler beim Aufbau eines erzählenden Spielfilms sind Ursache-Folge-Relation, Ort und Zeit. Ein Spielfilm bietet einem Ort über eine gewisse Zeit einen Platz der Fortsetzung, auf dem Ursächlichkeiten und Resultate aufeinander abfolgen können. In einem Spielfilm verbindet und motiviert die Elemente eine fiktive Wirklichkeit oder Welt, in die der Film gleichsam den Blick eröffnet.
Vom Standpunkt des Aufbaus eines Musikvideos her ist eine solche erzählerische Welt nicht unbedingt vonnöten, da vor allem die Musik es zusammenhält. Eine konkret hörbare Musik (und nicht nur eine "sichtbare", wie beim reinen Film der 1920er) begründet und berechtigt auch die "Musikalisierung" der Bilder, läßt daraus etwas entstehen, das auch von einem, dem eine nicht-erzählende Bildersprache befremdlich vorkommt, angenommen werden kann. Wenn die hörbare Stimme und nicht die sichtbare Örtlichkeit dem ganzen Dauer und Zusammengehörigkeit verleiht, müssen die Bilder nicht dadurch motiviert sein, wie sie sich in einen bestimmten Erzählverlauf einfügen. Es reicht aus, daß der Bilderstrom im Einklang mit der Musik "klingt" oder "swingt". Anstelle der realistischen Ästhetik (bei der der Film in gewisser Weise das Fenster für eine in Bildern festgehaltene Wirklichkeit ist) stellt die visuelle Ästhetik des Musikvideos an erster Stelle eine Ästhetik der Attraktivität dar, bei der das Anschauen und das Aufführen als solches schon das wichtigste sind, ohne eine eigentliche Notwendigkeit, von etwas "erzählt" zu haben.
Das Loslösung der Bilder weg vom Erzählen von Geschichten hin zu einer reinen Visualität, Beweglichkeit und Rhytmik ist zwar auch beim Musikvideo keine unbedingte Notwendigkeit. Sie ist jedoch eine Möglichkeit, die die Filmart des Musikvideos bereithält. Ein Musikvideo kann sehr wohl nichts weiter als eine mit Bildern untermalte Musik sein. Trotzdem kann sich von Zeit zu Zeit in ihnen die Utopie der Avantgardisten der 1920er realisieren, daß bewegte Bilder aus sich selbst heraus zur Musik werden.
Antti Pönni
Lektor an der Universität Oulu für das Fach Filmkunde
[Auf dem Musikvideofestival von Oulu am 28. & 29. August 2004 wurden jeweils zwei Kurzfilme von Germaine Dulac, Man Ray & Henri Chamotte vorgestellt]
Konsumenten der Hochkultur suchen ihre Kunstgenüsse wohl kaum im Angebot des Music Television. Überraschenderweise zeigt sich jedoch in der Kulturerscheinung der Musikvideos der Einfluß der Ästhetik des französischen Avantgarde-Films der 1920er
(ein Beitrag des finnischen Kulturjournals Kaltio aus Anlaß des Musikvideofestivals von Oulu vom 28. & 29. August 2004, übersetzt aus dem Finnischen)
"Musik aus Licht"
"Visuelle Symphonie". In derlei Begriffen sprach man vom Film im Frankreich der 1920er. Den führenden Köpfen der Avantgarde jener Zeit bestand der wichtigste Charakterzug des Stummfilms nicht in seiner Fähigkeit, Geschichten erzählen zu können, sondern in seinen visuellen Möglichkeiten. Anstelle davon, daß der Film als etwas den erzählerischen Formen in der Kunst, dem Theater und dem Roman Ähnliches begriffen wurde, vertrat man die Ansicht, daß er vor allen Dingen der Musik nahekomme.
Der Ausgangspunkt für einen Vergleich mit Musik war an und für sich einleuchtend gewesen: was die Musik für die Ohren ist, dies sollte der Film für die Augen sein - eine sichtbar werdende Musik. Paradoxerweise wurde diese Denkart gerade durch die Stummheit des Films noch unterstrichen: wo der Ton fehlt, hat der Film auf sein Publikum durch visuelle Mittel Einfluß zu nehmen. Wenn Musik mittels von Klängen, ohne, daß sie eine Geschichte erzählte, Gedanken und Gefühle erregen kann, dachte man sich, der Film könne mittels von Bildern das gleiche tun. Diese Idee formierte sich zu einer These der Avantgarde des französischen Films, die ganz im Mittelpunkt zu stehen kam.
Geschichten sind oberflächlich
Die Avantgarde der 1920er Frankreichs wird für gewöhnlich in eine erste und eine zweite Avantgarde aufgeteilt. Besonders der zu Anfang der 1920er vorherrschenden, als Erste Avantgarde oder Impressionismus bezeichneten Ausrichtung galt es als etwas wichtiges, die besondere Natur des Films aufzuspüren, einen Charakterzug zu finden, der ihn von den anderen Formen der Kunst unterschiede. Einen solchen sah man in der "Photogénie", der Fähigkeit der Filmkamera, die aufgezeichnete Realität zu einem Niveau anzuheben, wo diese sich auf eine neue und zuvor nicht wahrgenommene Art und Weise präsentiere. Obwohl impressionistische Filme denn auch Geschichten erzählten, war die Story oft nur Ausgangsbasis zum Hervorbringen der als dem Medium Film eigentlich innewohnend betrachteten Eigenschaften. Der den Spitzennamen der Impressionisten zuzurechnende Jean Epstein bemerkte im Jahre 1921: "Im allgemeinen vermittelt ein Film Geschichten nicht gut. (...) Warum also Geschichten erzählen, Stories, die immer eine Chronologie, hintereinander ablaufende Geschehnisse, ein graduelles Wechselspiel von Fakten und Emotionen voraussetzen? (...) Es gibt gar keine Geschichten. Geschichten hat es nie gegeben. Es gibt nur Situationen, ohne Kopf und Schwanz; ohne Anfang, ohne Mittelpunkt oder Schluß." "Natürlich kann ein Film eine Geschichte erzählen," bemerkte ihrerseits die sich zu den im Mittelpunkt stehenden Impressionisten zählende Germaine Dulac, "aber die Story allein ist noch nichts. Die Geschichte ist etwas oberflächliches."
Obwohl als erzählerisch einzustufende impressionistische Filme bis zum Ende der 1920er gemacht wurden, begann bereits vor Mitte der 1920er die Idee, daß man völlig und ganz auf eine Story verzichten könnte, immer stärker an Boden zu gewinnen. Der Gedanke als solcher war eigentlich nichts neues. Bereits im Jahre 1914 hatte der Kunstmaler Léopold Survage seine Vorstellung vom Film als einer Fortsetzung der abstrakten Kunstmalerei vorgestellt, als einer nicht-darstellenden, nicht-erzählerischen Malerei, als einen "Rhytmus von bunten Farben". Die Grundelemente eines "bunten Rhytmus" seien abstrakte visuelle Form, Rhytmus (anders herum gesagt, Bewegung und die mit ihr in der Form passierenden Veränderungen) und Farbe. Weiterhin stellte Survage fest, daß ein solches Werk vor allem mit Musik zu vergleichen wäre: auch bei einem "Rhytmus von bunten Farben" handelte es sich um Veränderungen in der Form, die in der Zeit vonstatten gehen.
Durchbruch des rhytmischen Schnitts
Einen bemerkenswerten Anschub der Idee des "musikalischen Films" leistete das von Abel Gance, dem vielleicht bekanntesten Vertreter des impressionistischen Films, im Jahre 1922 fertiggestellte, ins Eisenbahn-Milieu platzierte Melodrama La Roue ("Das Rad"). Der Film wurde zu einem Ereignis, von dem man im Frankreich der anfänglichen 1920er Notiz nahm. Dessen ursprüngliche Version belief sich von der Spieldauer her auf fast neun Stunden, und die Uraufführung für ein geladenes Publikum von 6000 Menschen im Dezember 1922 mußte auf drei aufeinander folgende Donnerstage verteilt werden. Nachdem die letzte Show beendet war, brach das Publikum in einen derartigen Sturm der Begeisterung aus, daß er nicht mehr enden wollte, vordem daß des Films letzter Streifen ein weiteres Mal abgespielt würde.
La Roue bereicherte den Impressionismus um ein neues Element. Obwohl der Film auch weiterhin eine Story hatte, enthielt er ebenso neuartige, rhytmisch geschnittene Montage-Abschnitte, die nahezu eigenständige, von der Erzählung und Geschichte abstehende Zusammenhänge bildeten - wie in belebten, blitzlichtartigen Bildern, von schneller werdendem Rhytmus, einer Eisenbahnstrecke, der Räder eines Zuges und Teile der Lok. Der rhytmische Schnitt des Films rief weit und breit Interesse hervor, und es gebrauchten ihn als ihr Lehrmaterial zum Beispiel die heranwachsenden Repräsentanten der Montage-Strömung in der Sowjet-Union. Den bedeutendsten Einfluß übte La Roue jedoch in Frankreich aus. Der Film-Klub C.A.S.A (Club des amis du septième art, "Klub der Freunde der siebenten Kunst") veranstaltete eine Sonderaufführung, während welcher von dem Film La Roue einzig und allein die nicht-erzählerischen Sequenzen, die hauptsächlich aus rhytmischen Schnitten bestanden, gezeigt wurden. Die Montage-Abschnitte des Films haben ganz entschieden dazu beigetragen, daß die sogenannte "Zweite Avantgarde" in den 1920ern zum Leben entfacht wurde, die sich schlußendlich vollständig vom Erzählerischen lossagte.
Kino Pur
Zu den sichtbarsten Bewunderern von La Roue zählte Germaine Dulac. Dulac war eine der bemerkenswertesten und vielseitigsten Gestalten der 1920er sowohl als Filme-Macherin als auch als Theoretikerin und eine der wenigen weiblichen Filme-Macher ihrer Zeit. Sie hatte sich zu Beginn ihrer Karriere gleich darauf verlegt, impressionistische Filme zu produzieren; zu den bekanntesten Werken aus Dulacs impressionistischer Zeit gehört die ironische Inszenierung einer unglücklichen Ehe, La Souriante Mme Beudet ("Die lächelnde Frau Beudet, 1923). Dulac machte sich auch als Regisseurin für einen der wenigen surrealistischen Filme, den auf das Drehbuch von Anton Artaud zurückgehenden Film La Coquille et le Clergyman ("Die Schnecke und der Pfaffe", 1927). Am ehesten erinnert man sich jedoch an Dulac als eine Verfechterin des sogenannten Kino Pur (cinema pur) - und gerade hier stellte das Stück La Roue von Gance eine äusserst wichtige Quelle der Inspiration dar. "Die menschlichen Figuren waren nicht mehr nur der einzige Faktor; neben diesen gelangten eher auch die Dauer von Bildern, deren Kontraste und Harmonien zu einer Schlüsselstellung. Die Schienen, die Lokomotive, der Dampfkessel, die Räder, der Druckmesser, der Rauch und die Tunnel: das jüngste Drama entfaltet sich mit ungeschliffenen, aufeinander abfolgenden Bewegungsablaufen und mit sich krümmenden Linien, und es bekommt die Anschauung, daß in Bewegung eine Kunst liegt ihre Berechtigung; endlich führt uns diese, rationell besehen, einem symphonischen Gedicht von Bildern, einer visuellen Symphonie entgegen, die alle bisher bekannten Schablonen sprengt," schrieb Dulac über La Roue.
Der Grundgedanke des reinen Films im Kino Pur war der, daß der Film zu reinem Gefühl zurückkehre, welches anstelle von einer Geschichte mit Hilfe von Mitteln erreicht würde, die ureigentümlich für den Film seien - die der Visualität, der Bewegung und des Rhytmus. Zielstellung des reinen Films war es, rein durch das Visuelle einen Einfluß auf Gefühle geltend zu machen, anders wie der sich auf das Theater gründende erzählende Spielfilm, welcher Gefühle durch äußere Mittel zu erreichen sucht, indem er Figuren von Personen und deren Schicksale als "Vermittler" der Gefühle einsetzt. Im Gegensatz zu theatralischer Sentimentalität sollte der Film nach Art von Musik Gefühle erwecken, indem er direkt auf die Wahrnehmung und die Sinnlichkeit einwirken kann. Dulac erklärt ihre Vorstellungen anhand des Beispiels von einem Blinden in einem Lichtspielhaus. Wenn in einem Kino ein gewöhnlicher Film mit einer Story vorgestellt würde, und der Blinde eine Begleitperson bei sich hätte, die ihm berichtete, was sich in dem Film tut, könnte der Blinde von den emotionellen Eindrücken des Films zumindest eine gute Hälfte erfahren. Anstelle davon sei der reine Film etwas, dessen visuelle Erfahrung einem Blinden zu erklären unmöglich ist.
Dulac setzte in der Praxis ihre Prinzipien auch in Taten um. Zu Ende der 1920er schuf sie eine Reihe von Kurzfilmen, die den Grundsätzen des reinen Films folgten, wie zum Beispiel Disque 972 ("Scheibe 972", 1928), Thèmes et variations, ("Themen und Variationen", 1928) und Étude cinégraphique sur un arabesque ("Lichtspieltechnische Übung zu einer Arabesque", 1929). Doch schon zuvor hatte ein gewisser Henri Chamotte sich die Idee des reinen Films in Kurzfilmen von ihm zur Mitte der 1920er zueigen gemacht, die so klingende Namen hatten wie Les jeux des reflets et de la vitesse ("Spiele von Reflexionen und Geschwindigkeit", 1925) und Cinq minutes de cinéma pur ("Fünf Minuten Kino Pur", 1925).
Fragmente: Ballet Mécanique
Ähnlich wie Dulac begeisterte sich auch der kubistische Kunstmaler Fernand Léger für die Montage-Sequenzen in La Roue. Außerdem, daß Léger bei dessen Erstaufführung unter den geladenen Gästen war, hatte er auch die Aufnahmen des Films vor Ort mitverfolgt. Beflügelt durch die Montage-Sequenzen des Films, schrieb Léger in einem Essay, daß in La Roue "aus der Maschine die führende Personengestalt, der führende Darsteller wird", und verglich den Film mit moderner Malkunst, bei der die Fragmentation des vorgestellten Objekts und der visuelle Wert des Objekts als solcher im Mittelpunkt stehe. Léger machte sich auch daran, einen völlig abstrakten Film zu entwerfen, bei dem das narrative Element ganz und gar ausgelichtet würde. Er konnte den amerikanischen Filme-Macher Dudley Murphy als seinen Kollegen gewinnen, und als das Endergebnis war im Jahre 1924 das Mechanische Ballett (Ballet Mécanique) fertiggestellt worden. Ballet Mécanique dürfte wohl der bekannteste Film der 1920er sein, von dem man sagen kann, daß er den Grundsätzen des puren Films folgt. Der Film baut sich auf gewissen sich wiederholenden Formen und Bewegungen auf. Zentrales Thema sind darin runde Formen und Kreisbewegungen, welche im Film auf vielerlei Art variiert werden. In dem Film kommen sowohl auf die gewöhnliche Weise gedrehte, als auch animierte Sequenzen vor (wie z.B. eine gezeichnete Chaplin-Figur). Aber auch die gewöhnlichen "etwas darstellenden" Bilder jedoch werden abstrahiert präsentiert, indem sie zu Fragmenten gemacht, sie aus ihren Bezügen herausgelöst sind. Durch den Einsatz von Nahaufnahmen werden gewöhnliche Gegenstände - oft verschiedenerlei Maschinen - so verändert dargestellt, daß sie nicht erkenntlich werden. Andererseits wird das Darstellerische der Bilder durch Wiederholungen zunichtegemacht. Ein markanteste Beispiel dafür ist eine vielmals hintereinander sich wiederholende Aufnahme einer treppensteigenden Waschsalon-Dame. Die Wiederholungen lenken das Beachten dessen, was das bewegte Bild eigentlich darstellt, ab, dahingehend, daß man auf das Bild als solches aufmerksam wird, welches sich rein in einer mechanischen Bewegung erschöpft. "In erster Linie wollte ich das Publikum verblüffen," erklärt Léger zu den Aufnahmen, "dann sollten sie dazu gebracht werden, verzweifelt nach einer Lösung des ganzen zu suchen, und zum Schluß dahin, daß sie ganz der Verzweiflung verfallen." Um die Anzahl der Wiederholungen zeitlich richtig abzustimmen, präsentierte Léger verschiedenen Publiken verschiedene Versionen, um herauszufinden, was am ehesten den von ihm erstrebten Effekt zeitigt.
"100% Dada"
Die von der Erzählkunst sich befreiende Zweite Avantgarde war jedoch nicht nur der "reine Film". Das Feld der Avantgarde in der Zeit wies eine Fülle von auseinanderlaufenden Gruppierungen und Strömungen auf. Ein und der gleiche Film konnte sehr wohl unter unterschiedlichen Betitelungen laufen. So wurde zum Beispiel vom Mechanischen Ballett als einem "abstrakten Film" und einem "kubistischen Film" gesprochen; ein gewisser Schriftsteller bemerkte sogar, daß "obwohl Léger eigentlich kein Dadaist ist, sein Ballet Mécanique 100% Dada ist." Gerade der Dadaismus und der als dessen Nachfolger zur Mitte der 1920er aufgekommene Surrealismus zählten neben dem "reinen Film" zu den bemerkenswertesten Strömungen der Zweiten Avantgarde. Anders wie Impressionismus und der reine Film suchten jedoch Dadaismus und Surrealismus nicht danach, den Film zur Kunst werden zu lassen; viel eher ließen sie sich eine Provokation, eine Opposition zu jeglicher Rationalität und ein In-Frage-Stellen der Position der Kunst angelegen sein. Wenn der Film keine "Kunst" war, bestand auch keine Notwendigkeit, ihn als "Musik" zu begreifen. Obwohl die Ausgangspunkte der Dadaisten und Surrealisten zur Idee des reinen Films von einander abwichen, gab es in etlichen fertiggestellten Filmen die gleichen Züge. Eine der auffallendsten Figuren sowohl auf dem Lager des Dada wie auch des Surrealismus war der in Frankreich sich eingelebte, amerikanische Photograph und bildende Künstler Man Ray (eig. Emmanuel Rudnitsky). Im Juli 1923 hatte Man Ray in Eile für eine von Tristan Tzara, der Leitfigur des Pariser Dada, in Szene gesetzte Abendgesellschaft, der "Coeur à barbe" (Bärtiges Herzen), den mehrminütigen Film Retour à la raison ("Die Rückkehr zur Vernunft") zusammengestellt. Der Film von Ray beinhaltet unter anderem auf Straßen und in Lustgärten aufgenommenes Material sowie direkt auf Film belichtetes Stückwerk. "In einige Fetzen des Films streute ich Salz und Pfeffer hinein wie ein Koch, der einen Braten zubereitet, in anderen vermischte ich kreuz und quer Pflöckchen und Stecknadeln, und ich belichtete dieses dann ein bis zwei Minuten," beschrieb Man Ray den Herstellungsprozeß des Films. Obwohl die ursprüngliche Idee zu diesem Film eine andere war, kann man auch diesen Film ähnlich dem Ballet Mécanique als einen abstrakten und vielleicht auch in gewisser Weise als einen "musikalischen" Film sehen. Das Soirée zum Coeur à barbe endete in einem skandalösen Zwischenfall, als der Anführer der opponierenden Gruppe von Surrealisten, André Breton, sich dazu hatte hinreißen lassen, auf einen bestimmten der aufgetretenen Schauspieler mit seinem Spazierstock einzuschlagen. Dieses Ereignis wird als die Beendigung der eigentlichen Dada-Strömung angesehen, welche durch den Surrealismus von Breton und Kollegen verdrängt wurde.
Der Traumblick
Auch die Surrealisten waren am Film interessiert. Für viele Surrealisten stellte der Film an und für sich etwas surrealistisches dar - er eröffnete den Weg zu einer die Alltäglichkeit übersteigenden, traumgleichen Erfahrung. André Breton pflegte die Angewohnheit, an Sonntagnachmittagen sich zufällig herausgesuchte Filmvorführungen anschauen zu gehen, und zwar solcherweise, daß er eine Zeitlang einem Film zuschaute, sich dann sogleich aufmachte, einem anderen eine Weile zuzuschauen, und so weiter fortfahrend. Das Resultat davon war, daß eine surrealistische Filmerfahrung aufkam, eine im Geiste des Betrachtenden entstehende, aus losen, aufblitzenden Streifenbildern sich zusammensetzende, unlogische, traumgleiche Bildmontage. Mit der gleichen Masche ging auch Man Ray vor, der zusätzlich an seine Augengläser farbige, das Licht brechende Prismen geklebt hatte, sodaß Filme in Schwarz-Weiß sich ihm als abstrakte Farbbilder zeigten. Surrealisten schrieben auch zahlreiche Filmdrehbücher, im Endeffekt wurden aber nur wenige richtiggehend surrealistische Filme gedreht. Der "Papst des Surrealismus" Breton hielt steif und fest an seinem Recht fest, bestimmen zu dürfen, was "echter" Surrealismus ist und was nicht. Der Abend der Erstaufführung von Dulacs La Coquille et le Clergyman geriet zu einem Chaos, da Breton und Kollegen im Lichtspielhaus eine skandalöse Szene anzettelten und Dulac blöde Kuh schimpften. Zum Schluß war der einzige Film in den 1920ern, den Breton mit seiner Gruppe - selbst darüber verblüfft - als surrealistisch durchgehen ließ, Un Chien andalou ("Ein andalusischer Hund", 1929) von Luis Buñuel und Salvador Dalí - wenngleich Dalí sich auf ein mögliches Szenario vorbereitet hatte, indem er Straßensteine im Vorführungssaal sich als Wurfgeschosse aufgebaut hatte.
Ein weiterer Versuch auf einen surrealistischen Film stellte das durch Man Ray im Jahre 1926 zustande gekommene "Filmgedicht" Emak Bakia vor; der Titel des Films war in baskischer Sprache und bedeutete "Laß mich in Frieden". In dem Film war teilweise gleiches Material zu sehen wie im Film Retour à la raison, doch ist er entschieden länger. Man Ray gibt von sich, daß er in dem Film versucht hätte, allen zugrundeliegenden Leitgedanken des Surrealismus Folge zu leisten - dem Irrationalismus, dem Automatismus, dem Sich-Lossagen von sichtbarer, dramatischer Logik und vom gewöhnlichen Erzählverlauf. Die bekannteste Bilderreihe des Films ist zu dessen Schluß, in der eine Frau mit glotzigen Augen in die Kamera schaut. Plötzlich öffnet sie dann ihre Augen: es zeigt sich, daß die zuvor gesehenen "Augen" nur auf die Lider aufgemalt waren. Diese Bildersequenz ist so ausgelegt worden, als daß sie sich auf die zwei unterschiedlichen Arten des "Sehens" beziehe - zum einen auf das Betrachten der gewöhnlichen Wirklichkeit und zum andern auf die mit geschlossenen Augen "zu schauende" surrealistische Welt der Träume und des Unbewußten. Zum Verdruß von Man Ray akzeptierte die Gruppe der Surrealisten den Film nicht. Weitere Filme von Man Ray waren L'étoile de mer ("Der Meeresstern", 1928) und Les Mystères du château du dé ("Die Geheimnisse des Loswürfel-Schlosses", 1929), für die der surrealistische Dichter Robert Desnos die Drehbücher handgeschrieben hatte.
Man Ray ist ein gutes Beispiel für eine Figur, die zwischen den verschiedenen Gruppen hin- und herlavierte. Eine Zeitlang war er mit dabei beim Drehprozeß für das Ballet Mécanique, wobei er offensichtlich auch einige für den Film verwendete Einstellungen aufgenommen hatte. Als mitwirkender Schauspieler war Man Ray 1924 in einem zweiten, wichtigen Film des gleichen Jahres mit von der Partie gewesen, in dem unter der Regie von Henri Chamottes Bruder René Clair (eig. René Chamotte) entstandenen Film Entr'acte ("Zwischenspiel"). Obwohl die eigentliche Dada-Bewegung mit der Szene auf der Coeur à barbe-Abendgesellschaft ihr Ende gefunden hatte, wurde Entr'acte weiterhin als ein dadaistischer Film angesehen. Seinem Namen zufolge war er als Zwischenspiel gedacht, und zwar für das avantgardistische Ballett Relâche ("Auftrittspause") von Francis Picabia. Das Drehbuch stammte von Picabia, nebst welchem, von hervorstehenden Avantgarde-Figuren, Man Ray, der bekannte Dada-Künstler Marcel Duchamp sowie der Komponist Eric Satie in dem Film Auftritte hatten. Eine "Tonspur" des Films sollte sich aus Gelärme und Gegenreden des aufgebrachten Publikums ergeben. Der Film selbst setzt sich aus einer Reihe von komischen Gags zusammen, in denen zum Beispiel unter anderen eine bärtige Ballerina, Picabia selbst, wie er mit einem Feuerwehrschlauch den Schach spielenden Man Ray und Duchamp vollspritzt, eine Jagd auf ein Straußenei, sowie eine Beerdigungsgesellschaft, die zu einem verworrenen Durcheinander ausartet, zu sehen sind. Im Programmprospekt der Inszenierung schrieb Picabia: "Das 'Entr'acte' bekennt sich nicht zu sehr vielem, vielleicht jedoch zum Genießen des Lebens; es glaubt eben an den Spaß des Erfinderischseins, es respektiert nichts weiter als das Verlangen, in Lachen auszubrechen."
Die Nachklänge: von der Musik der Bilder zum Musikvideo
Der Durchbruch des Tonfilms, als man auf die 1930er zuging, brachte das Ende eines Films mit sich, der sich an der Kraft des Bildes orientiert hatte. Die Sprache ersetzte die mit bildlichen Mitteln erzielten Effekte und der Film wurde zu dem von der Generation der 1920er scheel beäugten "gefilmten Theaterspiel". Die "reine", von jeglicher Erzählhandlung losgelöste Art und Weise, durch bewegte Bilder etwas zum Ausdruck zu bringen, war jedoch damit nicht ganz und gar verschwunden, sondern hatte ihren Fortbestand in verschiedenen Projekten der Avantgarde und bis zu einem gewissen Grad auch innerhalb des Mainstream-Films für die breiten Massen. Ein neues Beispiel für dessen Lebendigkeit ist das seit gut letzten zwei Jahrzehnten sich durch die Räume bewegende Musikvideo. Bei einem Musikvideo kann man vielleicht nicht gerade von einem Avantgarde-Film im eigentlichen Sinne des Wortes sprechen. Als eine Erscheinungsform des Ausdrucks hat es jedoch auf den weitspurigen Gefilden des Films als marginal verbliebene Mittel des filmischen Ausdrucks erneut zu einem sichtbaren Bestandteil der audiovisuellen Kultur gemacht. Da die Aufmachung bei einem Musikvideo nichts mit dem Erzählen von einer Geschichte zu tun zu haben braucht, bietet es sich an, dadurch sich Ausdruck zu verleihen, indem das Bild und die visuelle Kunst an der Stelle einer Story ganz in den Fokus genommen wird.
Ein "reines" Musikvideo gibt es jedoch nicht; in einzelnen Videos lassen sich auf unterschiedlichsten Wegen verschiedenartigste audiovisuelle und andere kulturelle Ausdrucksformen nutzen. In Anbetracht der Stellung des erzählenden Spielfilms ist es kein Wunder, daß in etlichen Videos auch dessen Methoden zur Anwendung kommen. Ein typisches erzählerisches Element in einem Video ist der auftretende Artist oder die Gruppe, um die herum das Ganze verankert ist. Auch mit Hilfe von Plätzen, seinem Aufzug und mit bestimmten Gegenständen kann eine "Erzählwelt" um die Auftretenden herum aufgebaut werden. Oft enthalten Videos Bruchstücke einer Erzählung oder sie formieren sich zu in sich abgeschlossene Minigeschichten.
Nichtsdestotrotz haben die Musikvideos dazu beigetragen, Stilmittel, die ohne ein Erzählen auskommen, die früher der Avantgarde zugerechnet wurden, zu einem festen Teil der populären Mainstream-Kultur werden zu lassen. Bei Musikvideos kann man innerhalb den Einstellungen beliebig von einem Ort und einer Zeit zur andern springen, und beim Schnitt kommen oft Rhytmus und Bewegungen eine wichtigere Bedeutung zu als dem Aufrechterhalten einer erzählerischen Einheit. Die Erkennungsmerkmale des "reinen" Films der 1920er, die Betonung des Visuellen, Bewegungsabläufe und deren Rhytmik machen den Kern ebenso des Musikvideos aus.
Die drei Grundpfeiler beim Aufbau eines erzählenden Spielfilms sind Ursache-Folge-Relation, Ort und Zeit. Ein Spielfilm bietet einem Ort über eine gewisse Zeit einen Platz der Fortsetzung, auf dem Ursächlichkeiten und Resultate aufeinander abfolgen können. In einem Spielfilm verbindet und motiviert die Elemente eine fiktive Wirklichkeit oder Welt, in die der Film gleichsam den Blick eröffnet.
Vom Standpunkt des Aufbaus eines Musikvideos her ist eine solche erzählerische Welt nicht unbedingt vonnöten, da vor allem die Musik es zusammenhält. Eine konkret hörbare Musik (und nicht nur eine "sichtbare", wie beim reinen Film der 1920er) begründet und berechtigt auch die "Musikalisierung" der Bilder, läßt daraus etwas entstehen, das auch von einem, dem eine nicht-erzählende Bildersprache befremdlich vorkommt, angenommen werden kann. Wenn die hörbare Stimme und nicht die sichtbare Örtlichkeit dem ganzen Dauer und Zusammengehörigkeit verleiht, müssen die Bilder nicht dadurch motiviert sein, wie sie sich in einen bestimmten Erzählverlauf einfügen. Es reicht aus, daß der Bilderstrom im Einklang mit der Musik "klingt" oder "swingt". Anstelle der realistischen Ästhetik (bei der der Film in gewisser Weise das Fenster für eine in Bildern festgehaltene Wirklichkeit ist) stellt die visuelle Ästhetik des Musikvideos an erster Stelle eine Ästhetik der Attraktivität dar, bei der das Anschauen und das Aufführen als solches schon das wichtigste sind, ohne eine eigentliche Notwendigkeit, von etwas "erzählt" zu haben.
Das Loslösung der Bilder weg vom Erzählen von Geschichten hin zu einer reinen Visualität, Beweglichkeit und Rhytmik ist zwar auch beim Musikvideo keine unbedingte Notwendigkeit. Sie ist jedoch eine Möglichkeit, die die Filmart des Musikvideos bereithält. Ein Musikvideo kann sehr wohl nichts weiter als eine mit Bildern untermalte Musik sein. Trotzdem kann sich von Zeit zu Zeit in ihnen die Utopie der Avantgardisten der 1920er realisieren, daß bewegte Bilder aus sich selbst heraus zur Musik werden.
Antti Pönni
Lektor an der Universität Oulu für das Fach Filmkunde
[Auf dem Musikvideofestival von Oulu am 28. & 29. August 2004 wurden jeweils zwei Kurzfilme von Germaine Dulac, Man Ray & Henri Chamotte vorgestellt]
libidopter - 29. Aug, 14:00