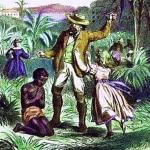Wie nur die vor sich hindösende Menschheit endlich wachkriegen, auf daß endlich etwas passierte auf eine bessere Welt hin - auf eine ohne Geld?!
Der Vater eines Schweinemessias
(ein Bericht aus dem Juli-Heft 2007 des finnischen Untergrund-Blattes Voima, übersetzt aus dem Finnischen)
Auf der im Jahre 1969 in der Kunsthalle von Helsinki veranstalteten Ausstellung der Jungen sorgte ein Schweinemessias von Harro Koskinen dafür, daß es einem Teil des Volkes den Magen umdrehte. Nach Anschauung des Laienpredigers Kyösti Laari stellte das gekreuzigte Schwein eine Gotteslästerung dar und er erließ wegen dem Artefakt eine Strafanzeige.
Der Prediger Laari wußte zu berichten, daß im Jahre 1906 die Bewohner der Insel Mauritius ein gekreuzigtes Schwein in einem ihrer Rituale herumgetragen hatten. Bald darauf sei es im Gefolge eines Erdbebens und Vulkanausbruchs um sie alle geschehen gewesen. Die Sicherheit der Nation war auf dem Waagscheit gestanden, sodaß er etwas unternehmen mußte.
Für die Gotteslästerung prasselte auf den Künstler Koskinen nach allen durchlaufenen Gerichtsbarkeitsstufen im Jahre 1974 eine Geldstrafe von 25'000 Finnmark herein. Selbst ein Präsident Kekkonen (der damalige volksnahe, durchaus etwas ulkige Glatzkopfindianer-Präsident Finnlands der ersten Zeit der Annäherung nach dem Kriege mit der Sowjetunion, der einmal auf Staatsbesuch in Tunesien zum Spaß eine Kokosnußpalme bestieg) konnte Koskinen nicht begnadigen, da jener sich nicht zu der Tat bekannte.
Als Ausgangspunkt für die Errichtung eines Schweinemessias diente Harro Koskinen die Entfremdungstheorie. Sinn und Zweck seiner Kunst war es gewesen, die Betrachter zu schockieren, indem die Welt der Werte der Gesellschaft auf den Kopf gestellt wurden. Zu einem Objekt der Parodie gerieten die Polizei, die Kirche und der Staat sowie auch die bürgerliche Kernfamilie.
"Die Schweinsproduktion verblüffte die Betrachter, da sie so völlig von der herkömmlichen bildenden Kunst abstach. Die Pop-Art der Amis wurde selbstverständlich akzeptiert, aber es wurde als sehr eigenartig befunden, mit jenem Stil zurechtzukommen", sinnt Koskinen über den Klamauk nach, den der Schweinemessias ausgelöst hatte.
Eine ähnliche Situation wiederholte sich zwanzig Jahre später im Zusammenhang mit dem Werk My Way - A Work In Progress von Teemu Mäki [von 1988, in dem eine Katze geschändigt wurde, wofür der 2002 später zum Doktor avancierte Lichtbildkünstler zu einer Geldstrafe verurteilt wurde]. Auch damals blieb eine Analyse des Inhalts aufgrund des angezettelten Skandals auf der Strecke.
Die Botschaft kam trotzdem beim Publikum an, "wenn man sie auch nicht durchkommen hatte lassen wollen. Man wollte eine solche totschweigen", kommentiert Harro das Vorgehen der Behörden.
"Der gesellschaftliche Umbruch in den 1960ern war herbe, ein Streben nach Freiheit folgte auf Industrialisierung und Verstädterung", fährt Koskinen fort. "Die Machthabenden wollten den Sockel der Freiheit umgestoßen haben. Disziplin sollte wieder zur Geltung kommen."
Der vom Rechten Lager in der Wahl zum Präsidenten von 1970 gebrauchte Slogan 'Die finnische Art zu leben' brachte Koskinen erneut dahin, sich mit den gesellschaftlichen Machtstrukturen auseinanderzusetzen. Mit ins Spiel kamen dieses Mal auch wirtschafts- und umweltpolitische Fragen.
Ein Markenstörumtrieb bezog sich sowohl auf die Republik Finnland wie auch auf die Ölindustrie. In der Reihe 'Die finnische Art zu leben' kam es zum Handschlag zwischen Staatsgewalt und Industrie.
An die Seite einer brennenden, zerreißenden und durchlöcherten Flagge Finnlands stellte Koskinen Logos von Firmen. Das Werk erzählte mehr über die Firmen, als es den Firmen lieb gewesen wäre. Koskinens Beobachtung von der im Zusammenhang mit Logos stattfindenden Aufladung an Werthaftigkeit war phantastisch und kam Jahrzehnte vor einem Zeitalter ähnlich dem heutigen des Aufbauens von Markenzeichen. Koskinen ging genau auf die Bilder ein, die man sich im Kopf von den Firmen macht, indem er die in den Logos verwendeten Wörter veränderte und verdrehte.
"Die Unternehmen schenkten den Arbeiten kein Interesse", stellt Koskinen fest. "Sprach man doch damals nur von Markenzeichen und nicht von Brands." Die Firmen waren noch nicht darauf gekommen, möglichst werte-aufgeladene Logos zu kreieren. Dieses hat sich späterhin von sich ergeben.
"Der gesellschaftliche Einfluß von Kunstwerken ist meiner Meinung nach marginal und wird übertrieben," läßt Harro Koskinen wissen, setzt aber hierauf: "Solange ich lebe, habe ich für eine bessere Gesellschaft gearbeit, aber sie ist noch schauriger geworden."
Die Welt wiederholt sich. Das Werk von Koskinen, das die Logos von Nokia und Shell vereint, ist weiterhin ein spitzzüngiges, wenn auch heutzutage mehr wegen der Nokia-Shell-Abenteuer eines Jorma Ollila als wegen den Verquickungen der Öl- und der Gummiindustrie.
"Heutzutage wird Zensur besser versteckt. Freilich ist die Gesellschaft vielförmiger und vielwertiger geworden, aber die Gedankenwelt der Menschen wird mit einem verblasenen Bla-bla aufgefüllt," gibt Koskinen weiter zu bedenken.
"Gleichzeitig wird die politische Beschlußfassung noch weiter von den Menschen hinweggerückt."
Es paßt in das Zeitbild, daß seiner Zeit die Staatsgewalt sich mit den Arbeiten von Koskinen befaßte, die Unternehmen aber den Parodien auf ihre Markenzeichen keine Beachtung zukommen ließen. In der heutigen Zeit könnte die Aufstellung sehr wohl eine umgekehrte sein, wollen die Politiker ihre Ohren gar nicht erst spitzen, die Unternehmen aber ihre Brands in Schutz nehmen.
Es ist im Grunde trotzdem alles beim alten gelieben, nichts hat sich von tief innen her verändert. "Die Marktwirtschaft ist dieser Tage der Gott," bringt es Koskinen auf den Punkt.
Jari Tamminen
Eine Ausstellung HARRO! im Kunstmuseum von Turku geht bis zum 9.9.07. Die Ausstellung veranschaulicht die Werke von Harro Koskinen aus einer Zeit von über 40 Jahren
(ein Bericht aus dem Juli-Heft 2007 des finnischen Untergrund-Blattes Voima, übersetzt aus dem Finnischen)
Auf der im Jahre 1969 in der Kunsthalle von Helsinki veranstalteten Ausstellung der Jungen sorgte ein Schweinemessias von Harro Koskinen dafür, daß es einem Teil des Volkes den Magen umdrehte. Nach Anschauung des Laienpredigers Kyösti Laari stellte das gekreuzigte Schwein eine Gotteslästerung dar und er erließ wegen dem Artefakt eine Strafanzeige.
Der Prediger Laari wußte zu berichten, daß im Jahre 1906 die Bewohner der Insel Mauritius ein gekreuzigtes Schwein in einem ihrer Rituale herumgetragen hatten. Bald darauf sei es im Gefolge eines Erdbebens und Vulkanausbruchs um sie alle geschehen gewesen. Die Sicherheit der Nation war auf dem Waagscheit gestanden, sodaß er etwas unternehmen mußte.
Für die Gotteslästerung prasselte auf den Künstler Koskinen nach allen durchlaufenen Gerichtsbarkeitsstufen im Jahre 1974 eine Geldstrafe von 25'000 Finnmark herein. Selbst ein Präsident Kekkonen (der damalige volksnahe, durchaus etwas ulkige Glatzkopfindianer-Präsident Finnlands der ersten Zeit der Annäherung nach dem Kriege mit der Sowjetunion, der einmal auf Staatsbesuch in Tunesien zum Spaß eine Kokosnußpalme bestieg) konnte Koskinen nicht begnadigen, da jener sich nicht zu der Tat bekannte.
Als Ausgangspunkt für die Errichtung eines Schweinemessias diente Harro Koskinen die Entfremdungstheorie. Sinn und Zweck seiner Kunst war es gewesen, die Betrachter zu schockieren, indem die Welt der Werte der Gesellschaft auf den Kopf gestellt wurden. Zu einem Objekt der Parodie gerieten die Polizei, die Kirche und der Staat sowie auch die bürgerliche Kernfamilie.
"Die Schweinsproduktion verblüffte die Betrachter, da sie so völlig von der herkömmlichen bildenden Kunst abstach. Die Pop-Art der Amis wurde selbstverständlich akzeptiert, aber es wurde als sehr eigenartig befunden, mit jenem Stil zurechtzukommen", sinnt Koskinen über den Klamauk nach, den der Schweinemessias ausgelöst hatte.
Eine ähnliche Situation wiederholte sich zwanzig Jahre später im Zusammenhang mit dem Werk My Way - A Work In Progress von Teemu Mäki [von 1988, in dem eine Katze geschändigt wurde, wofür der 2002 später zum Doktor avancierte Lichtbildkünstler zu einer Geldstrafe verurteilt wurde]. Auch damals blieb eine Analyse des Inhalts aufgrund des angezettelten Skandals auf der Strecke.
Die Botschaft kam trotzdem beim Publikum an, "wenn man sie auch nicht durchkommen hatte lassen wollen. Man wollte eine solche totschweigen", kommentiert Harro das Vorgehen der Behörden.
"Der gesellschaftliche Umbruch in den 1960ern war herbe, ein Streben nach Freiheit folgte auf Industrialisierung und Verstädterung", fährt Koskinen fort. "Die Machthabenden wollten den Sockel der Freiheit umgestoßen haben. Disziplin sollte wieder zur Geltung kommen."
Der vom Rechten Lager in der Wahl zum Präsidenten von 1970 gebrauchte Slogan 'Die finnische Art zu leben' brachte Koskinen erneut dahin, sich mit den gesellschaftlichen Machtstrukturen auseinanderzusetzen. Mit ins Spiel kamen dieses Mal auch wirtschafts- und umweltpolitische Fragen.
Ein Markenstörumtrieb bezog sich sowohl auf die Republik Finnland wie auch auf die Ölindustrie. In der Reihe 'Die finnische Art zu leben' kam es zum Handschlag zwischen Staatsgewalt und Industrie.
An die Seite einer brennenden, zerreißenden und durchlöcherten Flagge Finnlands stellte Koskinen Logos von Firmen. Das Werk erzählte mehr über die Firmen, als es den Firmen lieb gewesen wäre. Koskinens Beobachtung von der im Zusammenhang mit Logos stattfindenden Aufladung an Werthaftigkeit war phantastisch und kam Jahrzehnte vor einem Zeitalter ähnlich dem heutigen des Aufbauens von Markenzeichen. Koskinen ging genau auf die Bilder ein, die man sich im Kopf von den Firmen macht, indem er die in den Logos verwendeten Wörter veränderte und verdrehte.
"Die Unternehmen schenkten den Arbeiten kein Interesse", stellt Koskinen fest. "Sprach man doch damals nur von Markenzeichen und nicht von Brands." Die Firmen waren noch nicht darauf gekommen, möglichst werte-aufgeladene Logos zu kreieren. Dieses hat sich späterhin von sich ergeben.
"Der gesellschaftliche Einfluß von Kunstwerken ist meiner Meinung nach marginal und wird übertrieben," läßt Harro Koskinen wissen, setzt aber hierauf: "Solange ich lebe, habe ich für eine bessere Gesellschaft gearbeit, aber sie ist noch schauriger geworden."
Die Welt wiederholt sich. Das Werk von Koskinen, das die Logos von Nokia und Shell vereint, ist weiterhin ein spitzzüngiges, wenn auch heutzutage mehr wegen der Nokia-Shell-Abenteuer eines Jorma Ollila als wegen den Verquickungen der Öl- und der Gummiindustrie.
"Heutzutage wird Zensur besser versteckt. Freilich ist die Gesellschaft vielförmiger und vielwertiger geworden, aber die Gedankenwelt der Menschen wird mit einem verblasenen Bla-bla aufgefüllt," gibt Koskinen weiter zu bedenken.
"Gleichzeitig wird die politische Beschlußfassung noch weiter von den Menschen hinweggerückt."
Es paßt in das Zeitbild, daß seiner Zeit die Staatsgewalt sich mit den Arbeiten von Koskinen befaßte, die Unternehmen aber den Parodien auf ihre Markenzeichen keine Beachtung zukommen ließen. In der heutigen Zeit könnte die Aufstellung sehr wohl eine umgekehrte sein, wollen die Politiker ihre Ohren gar nicht erst spitzen, die Unternehmen aber ihre Brands in Schutz nehmen.
Es ist im Grunde trotzdem alles beim alten gelieben, nichts hat sich von tief innen her verändert. "Die Marktwirtschaft ist dieser Tage der Gott," bringt es Koskinen auf den Punkt.
Jari Tamminen
Eine Ausstellung HARRO! im Kunstmuseum von Turku geht bis zum 9.9.07. Die Ausstellung veranschaulicht die Werke von Harro Koskinen aus einer Zeit von über 40 Jahren
libidopter - 2. Aug, 12:13