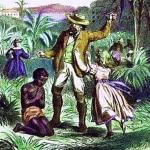Ohne mehr Liebe im Alltag kann man von einer Zukunft jenseits der Diktatur des Geldes nur träumen
Eine Generation getragen vom Ideal des 'Liebet-Euch-alle-Einander'? -
Eher eine Generation von 'Mach-mit-mir-Liebe'
Ehe wir gefühlsduselig ins Schwärmen kommen über die '60er Jahre, so
wie sie wirklich waren, sollten wir uns vor Augen halten, was für ein
kleiner Sprung es im Endeffekt vom Hippie zum Yuppie war.
(ein Kommentar des britischen Blattes The Guardian vom 19.5.2007,
übersetzt aus dem Englischen)
In nur etwas über vierzehn Tagen werden es vierzig Jahre sein seit der
Veröffentlichung des Albums Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band der Beatles.
Zu Tränen gerührte Nostalgiker der starken jungen Generationen werden
vermutlich auf einer intellektuellen Suche nach der verlorenen Zeit ihre
alten Vinyl-LP-Ausgaben der Scheibe hervorkramen, und sich vielleicht
wundern, wohin all jener beschworene Frieden samt all der Liebe und des
Verständnisses von damals hingekommen ist, eine Frage, die fast schon
so lange im Raum steht als es auch das Album gibt.
Paul McCartney gab eine Geschichte zum Besten, laut welcher er 1972
einmal von einem schwer enttäuschten Hippie gestellt wurde, von dem er
folgendes zu hören bekam: "Ach du lieber Gott! Oh Mann! In der Zeit, als
Sgt Pepper herausgekommen war, glaubten wir wirklich, daß dies jetzt die
Welt verändern würde." "Was ist passiert?"
Man kaufe sich die neueste Ausgabe des Magazins Rolling Stone, und es
wird einem eine mögliche Antwort hierauf geliefert. Die 1967 in San
Francisco gegründete Zeitschrift feiert ihr eigenes vierzigjähriges
Bestehensjubiläum mit einer Sonderausgabe, die vollgepackt ist mit
Reminiszenzen zu den '60er Jahren von Leuten wie Paul McCartney, Mick Jagger, Jack
Nicholson und Jane Fonda. Lange Zeit schon gegen den rechten Flügel der
Republikaner ausgerichtet, sind die für das Magazin Schreibenden -
wobei sie sich bei Gelegenheiten wie dieser in Reflektionen zu Ansichten
ihres Chefs und Grunders Jann Wenner ergehen, sich ihrer ganz sicher,
daß, obwohl die Freigeistler der 1960er sich bereits lange auf dem
Rückmarsch befunden haben, deren Philosophie reif ist für ein erneutes
Aufblühen. Ein einführender Leitartikel des Verfassers stellt die Behauptung
auf, daß alle Dinge von Bedeutung, die das 21. Jahrhundert bewegen, "im
Aktivismus der '60er Jahre ihre Wurzeln haben" und daß "die Werte jenes
Jahrzehnts nicht nur überlebt haben, sondern in vielerlei Hinsichten
das vorherrschende Wertesystem der breiten Massen in unserer Zeit
ausmachen." Der letztgenannte Punkt ist richtig, aber völlig andersherum. 1988
wurde der britische Rockmusik-Komponist Charles Shaar Murray in einem
Interview um eine mündliche Zusammenfassung gebeten zu einer
geschichtlichen Darstellung vom London der 60er-Jahre, Tage im Leben benannt, in
der immer wieder der Anspruch erhoben wird, daß die Ära ein goldenes
Zeitalter mit persönlichen Freiheiten gewesen wäre, die zu einer sensibel
sentimentalen Aufklärung geführt hätte; eine Zeit, die, laut einem der
beitragenden Schreiber, "weniger auf den Konsumenten ausgerichtet und
eine Zeit sein sollte, um mehr für die Gemeinschaft da zu sein, mehr
Sorge zu tragen." Murray zeigte sich nicht gerade so überzeugt. "Der
Durchmarsch vom Hippie zum Yuppie ist im Grunde weniger verschnörkelt
verlaufen, als die Leute gerne glauben möchten," sagte er. "Etliche der alten
Hippie-Sprüche könnten sehr gut von den Pseudo-Liberalen des rechten
Flügels gebraucht werden, was auch tatsächlich passiert. Den lästigen
Regierungsapparat, den wir alle auf den Rücken aufgespannt bekommen,
müssen wir loswerden, jeder soll tun dürfen, was er will - das läßt sich
sehr gut für den ungezwungenen Umgang, der unter Yuppies üblich ist,
auslegen, und dies ist das Erbe ebenjener Ära."
Man braucht nur ein paar der Zöglinge der 60er, die es im Leben zu Geld
gebracht haben, aufmarschieren zu lassen, um das, was er sagt, zu
verifizieren. Man sehe sich mal Felix Dennis an, diesen unternehmerischen
Langhaardackel, der eine Phase bei dem Magazin Oz und dabei eine Anklage
wegen öffentlichen Ärgernisses überlebte, und bewußt daraufhin solche
unzeitgeistmäßigen Zeitschriften auflegte, wie z.B. Maxim, Stuff und The
Week und ein Vermögen von 750 Millionen Pfund zusammenscheffelte
(letztes Jahr publizierte er Anleitungen für den Hausgebrauch mit dem Titel
'Wie wird man reich'). Richard Branson mag vielleicht ein
Wochenend-Hippie in den Augen des harten Kerns der Gegenkultur gewesen sein, immerhin hatte er eine von deren wenigen klaren Botschaften abgekupfert: daß
man, wenn man seinen Kapitalismus mit einer affektionierten Nonkonformität
paart, ein gemachter Mann ist. Das gleiche dürfte auf The Gap zutreffen
- wie Rolling Stone ebenso im San Francisco der 60er von Unternehmern
gegründet, die sahen, daß die konform ausgerichtete Welt einen großen
Anteil des Marktes unberührt läßt - und auf die segensreiche Anita
Roddick. Bevor sie den Body Shop an L'Oréal verkaufte, jenes mustergültige
Exemplar an ethischem Gebaren, unterhielt sie ein Geschäft, von dem man
glauben konnte, daß alles richtig herum lief, dessen Einstellung zur
Arbeitervertretung eine Verkündigung von 1996 auf den Punkt bringt: "Die
Firma kennt formell keinen Arbeiterverband an, der irgendeinen unserer
Beschäftigten vertreten würde, und sie plant auch nicht, dies zu tun."
Und wie steht es mit jenen Zöglingen der 60er, die in der Regierung
gelandet sind? "Ich war in der Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs der
'60er und '70er ein junger Mann," erinnerte uns Tony Blair neulich in
seiner Rücktrittsrede (im Sommer von 1967 war er gerade 14 geworden). Die
Anmerkung kam als Einführung zu ein paar Punkten in einer Anspielung
auf seine Hauptziele Mitte der '90er Jahre, mittels denen er das Land,
engstirnig Traditionen verhaftet, zu modernisieren trachtete, obwohl sie
genausogut hätte gemacht sein können, um jede Menge an Blair'schen
Totempfählen errichtet zu bekommen: die öffentlichen Dienste, die
menschlicher gemacht und privatisiert werden müssten, die Notwendigkeit der
Flexibilität eines Arbeitsplatzes, die Annahme der Idee des rechten Flügels
von den Abhängigkeiten des Wohlergehens, alles ein Echo - genau wie bei
Clintons Neuen Demokraten - der Vorstellungen der '60er von
wirtschaftlicher Unabhängigkeit und davon, den Staat, allzu oft den Millionen von
Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, für welche die
Generation des 'Liebet-Euch-Alle-Einander'-Typs immer überraschend wenig Zeit
hatte, den Rücken zukehrend, zu vermehrter Aktivität anzuspornen.
Falls jemand aufgrund der positiven Entwicklungen in der Gesellschaft
eine Affinität zum britischen Pol der 60er Jahre hegen sollte, nicht der
Anglo-Amerikanischen Gegenkultur muß man für jenen Wandel dankbar sein,
sondern, anstelle von lockig-flockigen Hippies, solchen eher steifen
Reformern wie Roy Jenkins und David Steel. Wer ruckblickend die
Erfindungen im damaligen Jahrzehnt der Politik der Kultur und der individuellen
Identität betrachtet, möge sich folgende Frage gefallen lassen: Hat
nicht jener Stimmungsumbruch auf höher See, ausser der Tatsache, daß er
die progressiven Linken von den Fragen, die die wirtschaftliche
Ungleichstellung der Menschen aufwirft, weggescheucht hat, die schnürlgerade
vorwärtsblickende Welt so verprellt, daß wir mit einer rechtslastigen
Vorherrschaft eines Thatcher/Reagan-Gespanns beschenkt wurden.
Wer sich die obenerwähnte Ausgabe des Magazins Rolling Stone erstehen
sollte, kann über all jenes zu einer abschließenden Betrachtung
gelangen: daß irgendwo im verblähten Aufschießen zusammen von bedeutungsvollem
Protest und von narzißtischen Kindskopf-Sperenzchen - wo sich
das Boykottieren des (ehedem rassendiskriminatorischen) Montgomery
Bus(-betriebs) zu einem Jim Morris der Doors, zum Beispiel, fügt, der Schlüssel zu
vielen der Fehler der 60er Jahre liegt.
Oh ja, und noch ein letztes: falls jemand dazu aufgelegt sein sollte,
die Sergeant Pepper-Platte zu ihrem Jubiläum abzuspielen, würde ich
raten, gleich zum Song Getting Better zu hüpfen, ein Lied, das, ohne sich
dessen bewußt zu sein, eine grundlegende Charakterumschreibung des
Dramaspiels der ganzen Ära in sich faßt: luftig-leichter Optimismus, der mit
der ernüchternden Erkenntnis kollidiert, daß, sowie all der blaue Dunst
sich verzogen hat, wieder alles wie eh und jeh sein wird. "Ich muß
zugeben, es geht uns besser / Stück für Stück besser, nach und nach", singt
da Paul McCartney (auf Englisch). Hieraufhin kommt dann gleich die
etwas säuerliche Zeile "Es kann nicht mehr schlimmer kommen", auf Wunsch
von John Lennon eingebaut.
John Harris
Eher eine Generation von 'Mach-mit-mir-Liebe'
Ehe wir gefühlsduselig ins Schwärmen kommen über die '60er Jahre, so
wie sie wirklich waren, sollten wir uns vor Augen halten, was für ein
kleiner Sprung es im Endeffekt vom Hippie zum Yuppie war.
(ein Kommentar des britischen Blattes The Guardian vom 19.5.2007,
übersetzt aus dem Englischen)
In nur etwas über vierzehn Tagen werden es vierzig Jahre sein seit der
Veröffentlichung des Albums Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band der Beatles.
Zu Tränen gerührte Nostalgiker der starken jungen Generationen werden
vermutlich auf einer intellektuellen Suche nach der verlorenen Zeit ihre
alten Vinyl-LP-Ausgaben der Scheibe hervorkramen, und sich vielleicht
wundern, wohin all jener beschworene Frieden samt all der Liebe und des
Verständnisses von damals hingekommen ist, eine Frage, die fast schon
so lange im Raum steht als es auch das Album gibt.
Paul McCartney gab eine Geschichte zum Besten, laut welcher er 1972
einmal von einem schwer enttäuschten Hippie gestellt wurde, von dem er
folgendes zu hören bekam: "Ach du lieber Gott! Oh Mann! In der Zeit, als
Sgt Pepper herausgekommen war, glaubten wir wirklich, daß dies jetzt die
Welt verändern würde." "Was ist passiert?"
Man kaufe sich die neueste Ausgabe des Magazins Rolling Stone, und es
wird einem eine mögliche Antwort hierauf geliefert. Die 1967 in San
Francisco gegründete Zeitschrift feiert ihr eigenes vierzigjähriges
Bestehensjubiläum mit einer Sonderausgabe, die vollgepackt ist mit
Reminiszenzen zu den '60er Jahren von Leuten wie Paul McCartney, Mick Jagger, Jack
Nicholson und Jane Fonda. Lange Zeit schon gegen den rechten Flügel der
Republikaner ausgerichtet, sind die für das Magazin Schreibenden -
wobei sie sich bei Gelegenheiten wie dieser in Reflektionen zu Ansichten
ihres Chefs und Grunders Jann Wenner ergehen, sich ihrer ganz sicher,
daß, obwohl die Freigeistler der 1960er sich bereits lange auf dem
Rückmarsch befunden haben, deren Philosophie reif ist für ein erneutes
Aufblühen. Ein einführender Leitartikel des Verfassers stellt die Behauptung
auf, daß alle Dinge von Bedeutung, die das 21. Jahrhundert bewegen, "im
Aktivismus der '60er Jahre ihre Wurzeln haben" und daß "die Werte jenes
Jahrzehnts nicht nur überlebt haben, sondern in vielerlei Hinsichten
das vorherrschende Wertesystem der breiten Massen in unserer Zeit
ausmachen." Der letztgenannte Punkt ist richtig, aber völlig andersherum. 1988
wurde der britische Rockmusik-Komponist Charles Shaar Murray in einem
Interview um eine mündliche Zusammenfassung gebeten zu einer
geschichtlichen Darstellung vom London der 60er-Jahre, Tage im Leben benannt, in
der immer wieder der Anspruch erhoben wird, daß die Ära ein goldenes
Zeitalter mit persönlichen Freiheiten gewesen wäre, die zu einer sensibel
sentimentalen Aufklärung geführt hätte; eine Zeit, die, laut einem der
beitragenden Schreiber, "weniger auf den Konsumenten ausgerichtet und
eine Zeit sein sollte, um mehr für die Gemeinschaft da zu sein, mehr
Sorge zu tragen." Murray zeigte sich nicht gerade so überzeugt. "Der
Durchmarsch vom Hippie zum Yuppie ist im Grunde weniger verschnörkelt
verlaufen, als die Leute gerne glauben möchten," sagte er. "Etliche der alten
Hippie-Sprüche könnten sehr gut von den Pseudo-Liberalen des rechten
Flügels gebraucht werden, was auch tatsächlich passiert. Den lästigen
Regierungsapparat, den wir alle auf den Rücken aufgespannt bekommen,
müssen wir loswerden, jeder soll tun dürfen, was er will - das läßt sich
sehr gut für den ungezwungenen Umgang, der unter Yuppies üblich ist,
auslegen, und dies ist das Erbe ebenjener Ära."
Man braucht nur ein paar der Zöglinge der 60er, die es im Leben zu Geld
gebracht haben, aufmarschieren zu lassen, um das, was er sagt, zu
verifizieren. Man sehe sich mal Felix Dennis an, diesen unternehmerischen
Langhaardackel, der eine Phase bei dem Magazin Oz und dabei eine Anklage
wegen öffentlichen Ärgernisses überlebte, und bewußt daraufhin solche
unzeitgeistmäßigen Zeitschriften auflegte, wie z.B. Maxim, Stuff und The
Week und ein Vermögen von 750 Millionen Pfund zusammenscheffelte
(letztes Jahr publizierte er Anleitungen für den Hausgebrauch mit dem Titel
'Wie wird man reich'). Richard Branson mag vielleicht ein
Wochenend-Hippie in den Augen des harten Kerns der Gegenkultur gewesen sein, immerhin hatte er eine von deren wenigen klaren Botschaften abgekupfert: daß
man, wenn man seinen Kapitalismus mit einer affektionierten Nonkonformität
paart, ein gemachter Mann ist. Das gleiche dürfte auf The Gap zutreffen
- wie Rolling Stone ebenso im San Francisco der 60er von Unternehmern
gegründet, die sahen, daß die konform ausgerichtete Welt einen großen
Anteil des Marktes unberührt läßt - und auf die segensreiche Anita
Roddick. Bevor sie den Body Shop an L'Oréal verkaufte, jenes mustergültige
Exemplar an ethischem Gebaren, unterhielt sie ein Geschäft, von dem man
glauben konnte, daß alles richtig herum lief, dessen Einstellung zur
Arbeitervertretung eine Verkündigung von 1996 auf den Punkt bringt: "Die
Firma kennt formell keinen Arbeiterverband an, der irgendeinen unserer
Beschäftigten vertreten würde, und sie plant auch nicht, dies zu tun."
Und wie steht es mit jenen Zöglingen der 60er, die in der Regierung
gelandet sind? "Ich war in der Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs der
'60er und '70er ein junger Mann," erinnerte uns Tony Blair neulich in
seiner Rücktrittsrede (im Sommer von 1967 war er gerade 14 geworden). Die
Anmerkung kam als Einführung zu ein paar Punkten in einer Anspielung
auf seine Hauptziele Mitte der '90er Jahre, mittels denen er das Land,
engstirnig Traditionen verhaftet, zu modernisieren trachtete, obwohl sie
genausogut hätte gemacht sein können, um jede Menge an Blair'schen
Totempfählen errichtet zu bekommen: die öffentlichen Dienste, die
menschlicher gemacht und privatisiert werden müssten, die Notwendigkeit der
Flexibilität eines Arbeitsplatzes, die Annahme der Idee des rechten Flügels
von den Abhängigkeiten des Wohlergehens, alles ein Echo - genau wie bei
Clintons Neuen Demokraten - der Vorstellungen der '60er von
wirtschaftlicher Unabhängigkeit und davon, den Staat, allzu oft den Millionen von
Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, für welche die
Generation des 'Liebet-Euch-Alle-Einander'-Typs immer überraschend wenig Zeit
hatte, den Rücken zukehrend, zu vermehrter Aktivität anzuspornen.
Falls jemand aufgrund der positiven Entwicklungen in der Gesellschaft
eine Affinität zum britischen Pol der 60er Jahre hegen sollte, nicht der
Anglo-Amerikanischen Gegenkultur muß man für jenen Wandel dankbar sein,
sondern, anstelle von lockig-flockigen Hippies, solchen eher steifen
Reformern wie Roy Jenkins und David Steel. Wer ruckblickend die
Erfindungen im damaligen Jahrzehnt der Politik der Kultur und der individuellen
Identität betrachtet, möge sich folgende Frage gefallen lassen: Hat
nicht jener Stimmungsumbruch auf höher See, ausser der Tatsache, daß er
die progressiven Linken von den Fragen, die die wirtschaftliche
Ungleichstellung der Menschen aufwirft, weggescheucht hat, die schnürlgerade
vorwärtsblickende Welt so verprellt, daß wir mit einer rechtslastigen
Vorherrschaft eines Thatcher/Reagan-Gespanns beschenkt wurden.
Wer sich die obenerwähnte Ausgabe des Magazins Rolling Stone erstehen
sollte, kann über all jenes zu einer abschließenden Betrachtung
gelangen: daß irgendwo im verblähten Aufschießen zusammen von bedeutungsvollem
Protest und von narzißtischen Kindskopf-Sperenzchen - wo sich
das Boykottieren des (ehedem rassendiskriminatorischen) Montgomery
Bus(-betriebs) zu einem Jim Morris der Doors, zum Beispiel, fügt, der Schlüssel zu
vielen der Fehler der 60er Jahre liegt.
Oh ja, und noch ein letztes: falls jemand dazu aufgelegt sein sollte,
die Sergeant Pepper-Platte zu ihrem Jubiläum abzuspielen, würde ich
raten, gleich zum Song Getting Better zu hüpfen, ein Lied, das, ohne sich
dessen bewußt zu sein, eine grundlegende Charakterumschreibung des
Dramaspiels der ganzen Ära in sich faßt: luftig-leichter Optimismus, der mit
der ernüchternden Erkenntnis kollidiert, daß, sowie all der blaue Dunst
sich verzogen hat, wieder alles wie eh und jeh sein wird. "Ich muß
zugeben, es geht uns besser / Stück für Stück besser, nach und nach", singt
da Paul McCartney (auf Englisch). Hieraufhin kommt dann gleich die
etwas säuerliche Zeile "Es kann nicht mehr schlimmer kommen", auf Wunsch
von John Lennon eingebaut.
John Harris
libidopter - 22. Mai, 17:25